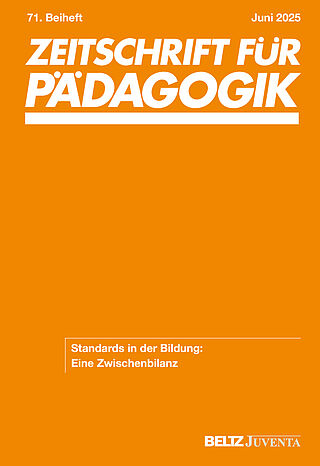- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Thementeil: Die Rolle der Lehrkraft für die Unterrichtsqualität und den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern
Dirk Richter/Petra Stanat/Hans Anand Pant
Die Rolle der Lehrkraft für die Unterrichtsqualität und den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern. Einführung in den Thementeil
Thamar Voss/Mareike Kunter/Johanna Seiz/Verena Hoehne/Jürgen Baumert
Die Bedeutung des pädagogisch-psychologischen Wissens von angehenden Lehrkräften für die Unterrichtsqualität
In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob das pädagogisch-psychologische Wissen (PPK) von angehenden Lehrkräften bedeutsam ist für deren späteren Unterrichtserfolg. PPK, definiert als Wissen, das zur Gestaltung des Unterrichts in verschiedenen Fächern notwendig ist, wurde anhand eines Testinstruments mit 39 Items erfasst (Voss, Kunter & Baumert, 2011). 181 Lehramtskandidatinnen und -kandidaten wurden während des Referendariats getestet, und deren 7 968 Schülerinnen und Schüler bearbeiteten zwei Jahre später in einer Follow-up-Erhebung Fragebögen zur Unterrichtsqualität. Mithilfe von Mehrebenen-Strukturgleichungsmodellen wurde gezeigt, dass PPK der angehenden Lehrkräfte statistisch signifikant die spätere Effizienz der Klassenführung sowie die konstruktive Lernunterstützung vorhersagte. Für das Potenzial zur kognitiven Aktivierung im Unterricht erwies sich PPK hingegen als nicht bedeutsam.
Schlagworte: Lehrerkompetenz, Professionswissen, Unterrichtsqualität, prädiktive Validität, Mehrebenen-Strukturgleichungsmodelle
Uta Klusmann/Dirk Richter
Beanspruchungserleben von Lehrkräften und Schülerleistung. Eine Analyse des IQB-Ländervergleichs in der Primarstufe
Das Wissen und Können von Lehrkräften hat einen bedeutsamen Effekt auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern. Darüber hinaus wird angenommen, dass auch emotional-motivationale Erlebensqualitäten der Lehrkraft, wie die berufliche Beanspruchung, für die Schülerinnen und Schüler eine Rolle spielen. Die vorliegende Studie untersucht, inwieweit die berufliche Beanspruchung von Lehrkräften, operationalisiert über die emotionale Erschöpfung, in Zusammenhang mit der Leistung ihrer Schülerinnen und Schüler steht. Auf Basis einer repräsentativen Stichprobe des IQB-Ländervergleichs für die Primarstufe kann gezeigt werden, dass die emotionale Erschöpfung der Lehrkräfte negativ mit der Testleistung der Schülerinnen und Schüler in Mathematik und im Lesen zusammenhängt. Für die mathematische Kompetenz sind die Befunde auch unter Kontrolle von Lehrermerkmalen wie Berufserfahrung, Arbeitsumfang und Qualifikation im Fach sowie von soziodemografischen, motivationalen und kognitiven Voraussetzungen auf Ebene der Schüler sowie der Klassenkomposition stabil. Für die Kompetenz im Lesen bleibt der Zusammenhang nach Kontrolle der Kompositionsmerkmale der Klasse nicht mehr bestehen.
Schlagworte: Lehrkräfte, emotionale Erschöpfung, Beanspruchung, mathematische Kompetenz, Lesekompetenz
Dirk Richter/Katrin Böhme/Michael Becker/Hans Anand Pant/Petra Stanat
Überzeugungen von Lehrkräften zu den Funktionen von Vergleichsarbeiten. Zusammenhänge zu Veränderungen im Unterricht und den Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern
Die Vergleichsarbeiten (VERA) sind seit mehreren Jahren ein wichtiges Instrument der Kompetenzdiagnostik, das auf den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz basiert. Sie dienen in erster Linie der Unterrichts- und Schulentwicklung, werden teilweise aber auch zur flächendeckenden Information der Schulaufsicht über den Leistungsstand von Einzelschulen genutzt. Der vorliegende Beitrag untersucht, inwieweit diese Funktionen von Lehrkräften wahrgenommen werden und in welcher Beziehung sie zum Unterricht der Lehrkräfte und den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler stehen. Die Studie basiert auf Daten des IQB-Ländervergleichs 2011 in der Primarstufe, in dem Kompetenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik erhoben wurden. Die Analysen zeigen, dass Lehrkräfte, die VERA als Mittel der Unterrichtsentwicklung begreifen, ihren Unterricht verstärkt auf die Entwicklung von Kompetenzen ausrichten und eine stärkere Differenzierung im Unterricht vornehmen. Weiterhin erreichen Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften mit diesen Überzeugungen bessere Ergebnisse im Lesen und in Mathematik, auch nach Berücksichtigung individueller und klassenbezogener Hintergrundmerkmale.
Schlagworte: Funktionen von Schulleistungstests, Grundschule, Ländervergleich, Lesekompetenz, mathematische Kompetenzen
Inger Marie Dalehefte/Heike Wendt/Olaf Köller/Helene Wagner/Marcus Pietsch/Brigitte Döring/Claudia Fischer/Wilfried Bos
Bilanz von neun Jahren SINUS an Grundschulen in Deutschland. Evaluation der mathematikbezogenen Daten im Rahmen von TIMSS 2011
Dieser Beitrag stellt erste Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitforschung zum Programm SINUS an Grundschulen (SGS) vor. Um Dimensionen der Wirksamkeit des Programms zu betrachten, werden mathematische Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern sowie das Weiterbildungs- und Kooperationsverhalten von Mathematiklehrkräften an SINUS-Grundschulen analysiert und mit Ergebnissen der für Deutschland repräsentativen Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 verglichen. Es wird u. a. deutlich, dass Mathematiklehrkräfte an SINUS-Grundschulen im Vergleich zu den im Rahmen von TIMSS befragten Kolleginnen und Kollegen von Professionalisierungsaspekten berichten, die eng mit dem SINUS-Ansatz einhergehen. Auf Schülerebene können bei den Schülerinnen und Schülern an SINUS-Grundschulen höhere Kompetenzwerte in Mathematik festgestellt werden.
Schlagworte: Lehrerfortbildung, Qualitätsentwicklung, Evaluation, TIMSS, Mathematik
Deutscher Bildungsserver – www.bildungsserver.de
Linktipps zum Thema „Die Rolle der Lehrkraft für die Unterrichtsqualität und den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern“
Allgemeiner Teil
Jutta Breithausen
Bildung und Sachlichkeit
Im Ausgang von der These, dass Sachlichkeit ein zentrales Kennzeichen von Bildung ist, wird erörtert, inwiefern die Beziehung von Sachlichkeit und Bildung aktuell gefährdet ist. Indizien der Gefährdung sind sowohl die Ontologisierung der Sache als auch die zwanghafte Ineinssetzung von Sachlichkeit mit datenbasierter Objektivität. Die gegenwärtigen output-orientierten Objektivierungen von Lerngegenständen wurden inzwischen häufig kritisiert und ihre negativen Folgen empirisch belegt. Kaum Beachtung fand hingegen eine über praktische Lehr- und Lernzusammenhänge hinausweisende Frage nach dem Verhältnis von Sachlichkeit und Bildung. Die folgende, an Philosophie und Kunst anknüpfende Begriffsanalyse bildet eine Reflexionsfolie, mit der Sachlichkeit in ihrer bildungstheoretischen Bedeutung hervorzuheben und gegen Engführungen zu verteidigen ist.
Schlagworte: Bildung, Sachlichkeit, Ontologie, Objektivität, Kritik
Michael Thoma
Foucaultsche Genealogie als historiographisches Verfahren kritischer Berufsbildungsforschung. Grundlagen, Perspektiven und Einsichten
Im Beitrag wird die Genealogie im Anschluss an den französischen Philosophen und Historiker Michel Foucault als eine spezifische Art kritisch-historischer Berufsbildungsforschung dargestellt. Nach einer Entfaltung allgemeiner Prinzipien eines genealogischen Herangehens und einer Bezugnahme der daraus für die eigene Untersuchung folgenden forschungsmethodischen Implikationen, werden anhand des Konzepts der ‚beruflichen Handlungskompetenz‘, das gegenwärtig als Leitziel beruflicher Bildung gilt, ein genealogisches Forschungsdesign skizziert und zentrale Befunde dargestellt. Der Beitrag schließt mit Einsichten einer genealogischen Kritik.
Schlagworte: Genealogie, berufliche Handlungskompetenz, Historiographie, kritische Berufsbildungsforschung, Diskurs
Daniela J. Jäger
Zwischen Empowerment und Kontrolle. Die praktische Umsetzung des New Public Management und Professioneller Lerngemeinschaften in Kanada. Eine Fallstudie
Um zu untersuchen, welche Merkmalskombinationen eine positive Bildungsperformanz erzeugen, wird in diesem Artikel anhand einer best-case-Fallanalyse die Umsetzung von New Public Management (NPM) in Kombination mit Professionellen Lerngemeinschaften (PLG) in Alberta, Kanada, analysiert. Mittels einer Daten- und Methodentriangulation werden die spezifischen Merkmalskombinationen sowie Unterstützungssysteme herausgearbeitet. Zudem wird die Kombination von NPM und PLG diskutiert. Es zeigt sich u. a., dass Wettbewerbselemente des NPM eine geringere Rolle spielen als die Zusammenarbeit der Akteure auf horizontaler und vertikaler Ebene (PLG), die Professionalisierung sowie die Unterstützung der Akteure.
Schlagworte: Governance, Kanada, New Public Management, Professionelle Lerngemeinschaften, Unterstützungssysteme
Besprechungen
Marcelo Caruso
Heinrich Bosse: Bildungsrevolution 1770 – 1830 (herausgegeben mit einem Gespräch von Nacim Ghanbari).
Marcus Syring
Colin Cramer: Entwicklung von Professionalität in der Lehrerbildung. Empirische Befunde zu Eingangsbedingungen, Prozessmerkmalen und Ausbildungserfahrungen Lehramtsstudierender.
Dokumentation
Pädagogische Neuerscheinungen