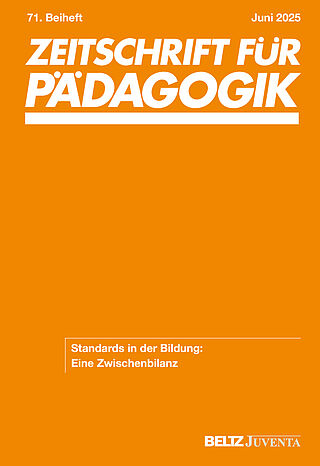- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
| Zeitschrift für Pädagogik - Inhaltsverzeichnis | |
| Jahrgang 48 – Heft 3 – Mai/Juni 2002 | |
Essay | |
Thema: Betriebliche Weiterbildung | |
| 317 | Philipp Gonon |
| Der Betrieb als Erzieher – Knappheit als pädagogische Herausforderung | |
| Zusammenfassung: Nicht nur die Auszubildenden, sondern alle Betriebsangehörigen sind einem starken erziehlichen Anspruch ausgesetzt, wenn es darum geht, sich auf ‚neue Anforderungen‘ der globalen Ökonomie auszurichten. Darüber hinaus wird auch dem Bildungswesen und der Gesellschaft insgesamt nahe gelegt, sich auf betriebliche Bedingungen einstellen: Umgang mit Knappheit, Flexibilität und – vermittelt durch das Vorbild des Entrepreneurs – Unternehmertum sollen auf Wechselfälle individueller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen vorbereiten. Wir können demgemäß eine innerbetriebliche, intermediäre und gesellschaftliche Perspektive des Betriebes als Erzieher unterscheiden. Innovationsbereitschaft, Fähigkeit zur Teamarbeit und das Streben nach Effizienz sind die hierbei herausragenden Tugenden. | |
| 336 | Karin Büchter |
| Betriebliche Weiterbildung – Ihre historische Kontinuität und Durchsetzung in Theorie und Praxis | |
Zusammenfassung: Die Aufmerksamkeit, die betriebliche Weiterbildung in der wissenschaftlichen Theorie und in der Berufsbildungspolitik während der letzten zwanzig Jahre erfahren hat, lässt sich nicht lediglich sachlogisch begründen, sondern sie ist Ergebnis einer kontinuierlichen historischen Entwicklung, in deren Verlauf sich das betriebliche Interesse an weitgehend selbst verwalteten Modi der Qualifizierung und Sozialintegration von Beschäftigten durchgesetzt hat. Anhand von einzelnen historischen Bausteinen aus Theorie und Praxis soll im Folgenden ein Einblick in Begründungen und Bemühungen zur industriebetrieblichen Bindung von Weiterbildung im 20. Jahrhundert – und zwar vor der erziehungswissenschaftlichen ‚Entdeckung‘ betrieblicher Weiterbildung in den 80er-Jahren – gegeben werden. | |
| 356 | Peter Dehnbostel |
| Bilanz und Perspektiven der Lernortforschung in der beruflichen Bildung | |
| Zusammenfassung: Die Lernortforschung gehört zu den disziplinären Kernthemen der Berufsbildungsforschung. Seit der Lernortkonzeption des Deutschen Bildungsrats in den 1970er-Jahren werden das Lernortkonzept und Ansätze einer Theorie der Lernorte kontrovers diskutiert, unterschiedliche Modelle von Lernortverbünden und Lernortkooperationen werden realisiert und analysiert. Auch die Erschließung und Gestaltung von arbeitsintegrierten Lernorten gewinnt angesichts der Renaissance des Lernens in der Arbeit zunehmende Bedeutung. In der Berufsbildung und betrieblichen Weiterbildung erfolgt eine Differenzierung, Pluralisierung und Entgrenzung von Lernorten. Lernende Unternehmen und Netzwerke sind der vorläufige Endpunkt dieser Entwicklung. In diesem Beitrag wird die Lernortforschung vor diesem Hintergrund bilanziert, und es werden Desiderate und Perspektiven aufgezeigt. | |
| 378 | Volker Bank |
| Controlling betrieblicher Weiterbildung zwischen Hoffnung und Illusion – oder: Auch im Westen nicht viel Neues | |
| Zusammenfassung: Dieser Beitrag liefert zunächst eine Übersicht über den Grundkonsens, der nach einer Analyse der aktuelleren im deutschsprachigen Raum wie in den angelsächsischen Ländern, in Frankreich und der Schweiz verfügbaren einschlägigen Veröffentlichungen deutlich geworden ist. Der Autor unternimmt im Folgenden den Versuch, seine eigene Kritik an der großen Zahl publizierter Patentrezepte zu Fragen des Controllings in der betrieblichen Weiterbildung nicht bloß zu aktualisieren, sondern auch zu überschreiten und konstruktiv die Suche nach der Möglichkeit eines Weiterbildungscontrollings zu erneuern. | |
Allgemeiner Teil | |
| 398 | Jürgen Reyer |
| Sozialpädagogik - ein Nachruf | |
| Zusammenfassung: Mit Bezug auf die kürzlich erschienene zweite Auflage des „Handbuchs der Sozialarbeit/Sozialpädagogik“ (erste Auflage 1984) sieht der Beitrag das Projekt einer disziplinären Sozialpädagogik unter dem Dach der Erziehungswissenschaft als gescheitert an. Der Beginn des Scheiterns wird nicht in neueren Entwicklungen gesehen, sondern in die Zeit der Weimarer Republik datiert. Damals begann jenes schwierige, bis heute nicht geklärte Verhältnis zwischen der ‚Fürsorgewissenschaft‘ (heute: ‚Sozialarbeitswissenschaft‘) und der Sozialpädagogik. | |
| 414 | Hans Peter Henecka/Frank Lipowsky |
| Quo vadis magister? – Berufliche Wege von Lehramtsabsolventen | |
| Zusammenfassung: Das Heidelberger Forschungsprojekt „Wege in den Beruf“ untersucht die beruflichen Wege baden-württembergischer Lehramtsabsolventen, die zwischen 1995 und 1997 ihr 1. Staatsexamen für Grund-, Haupt- oder Realschulen ablegten. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass ungefähr die Hälfte aller Absolventen bis zum Frühjahr 2000 immer noch keine feste Stelle im staatlichen Schuldienst hatte. Gerade dieser Gruppe mit ihren teilweise höchst individualisierten beruflichen Um- und Neuorientierungen, aber auch den hier vorfindbaren offenen oder verdeckten Formen und Bewältigungsstrategien von Lehrerarbeitslosigkeit gilt das Hauptinteresse der Projektstudie. | |
| Besprechungen | |
| 435 | Heinz-Elmar Tenorth |
| Hélène Leenders: Der Fall Montessori. Die Geschichte einer reformpädagogischen Erziehungskonzeption im italienischen Faschismus | |
| 438 | Marc Depaepe |
| Christine Hofer: Die pädagogische Anthroploige Maria Montessoris - oder: Die Erziehung zum neuen Menschen | |
| 442 | Heidemari Kemnitz |
| Ann Taylor Allen: Feminismus und Mütterlichkeit in Deutschland, 1800 - 1914 | |
| 446 | Sabine Andresen |
| Petra Gester/Christian Nürnberger: Der Erziehungsnotstand. Wie wir die Zukunft unserer Kinder retten. | |
| Susanne Gasche: Die Erziehungskatastrophe. Kinder brauchen starke Eltern | |
| 451 | Habilitationen und Promotionen in Pädagogik 2001 |
| 489 | Pädagogische Neuerscheinungen |