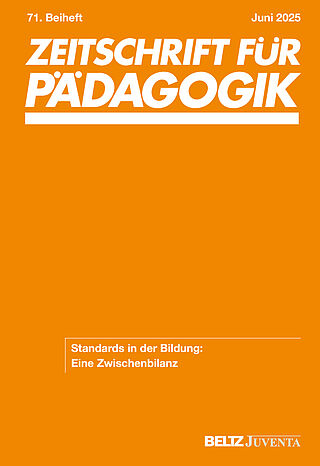- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Thementeil: Kritik der politischen Bildung
Roland Reichenbach/Ludwig Pongratz
Einleitung
Carsten Bünger/Ralf Mayer
Erfahrung –Wachstum – Demokratie? Bildungstheoretische Anfragen an Deweys Demokratiebegriff und dessen programmatische Rezeption
In der jüngeren, „demokratiepädagogischen“ Konzeption von politischer Bildung wird zur Förderung kooperativer Handlungskompetenzen nach Ergänzungen und Alternativen zum kognitiv orientierten Politikunterricht gesucht. In diesem Kontext erhält der Begriff der Erfahrung einen programmatischen Stellenwert, der unter Rückgriff auf die pragmatistische Demokratietheorie John Deweys erläutert wird. Der Aufsatz untersucht Deweys Vorstellung von Demokratie als einer gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung im Hinblick auf die entsprechende demokratiepädagogische Rezeption. Dabei zeigt sich, dass die ambivalenten Aspekte der Konzeption Deweys – wie der Gedanke der „Unmittelbarkeit“, des „Wachstums“ und der Demokratie als Ideal der Gemeinschaft – nicht nur reproduziert, sondern verschärft werden
Bettina Lösch
Internationale und europäische Bedingungen politischer Bildung – zur Kritik der European Citizenship Education
Im Zuge der Internationalisierung und Europäisierung von politischen und ökonomischen Prozessen verändern sich die Bedingungen für politische Bildung, die bislang inhaltlich wie institutionell nationalstaatlich ausgerichtet war. Die Einschätzungen gehen dahingehend auseinander, inwieweit diese (Transformations-)Prozesse neue Möglichkeiten für die politische Bildungsarbeit eröffnen oder gegenteilig die etablierte Praxis eher weiter beschneiden. Der Beitrag skizziert insofern einige europäische Initiativen, die sich auf die institutionelle und inhaltliche Ausrichtung politischer Bildung auswirken. Das Demokratieverständnis der European Citizenship Education wird diskutiert und eine erweiterte Perspektive einer Global Citizenship Education eröffnet. Eine kritische politische Bildung, wie sie konzeptionell dem Beitrag zu Grunde liegt, verfolgt eine Weltperspektive, die eine europazentrierte Sichtweise übersteigt, alte Ausschlussmechanismen des Nationalstaates zu überwinden sucht sowie bei einem differenzierten Subjekt- und Demokratiebegriff ansetzt.
Sibylle Reinhardt
Schulleben und Unterricht – nur der Zusammenhang bildet politisch und demokratisch
Die Nachkriegskontroverse um soziale oder politische Erziehung wurde als Auseinandersetzung um ein BLK-Modellprogramm fünf Jahrzehnte später wiederholt. Studien der letzten zehn Jahre zeigen, dass soziales Lernen nicht zugleich politisches Lernen bedeutet oder bewirkt, weil die Sphären des Privaten und des Öffentlichen sich unterscheiden. Die zentrale Kompetenz der Domäne Demokratie ist Konfliktfähigkeit, die als Kontroversprinzip – neben dem Gang vom Sozialen zum Politischen – die fachdidaktischen Prinzipien des Politikunterrichts kennzeichnet. Dieselbe Entwicklung können auch Projekte des service-learning und des BLK-Modellprogramms nehmen.
Horst Biedermann/Roland Reichenbach
Die empirische Erforschung der politischen Bildung und das Konzept der politischen Urteilskompetenz
Die Forschungslage zur politischen Bildung fällt im Vergleich zu anderen Fachbereichen auch im deutschen Sprachraum eher schmal aus. Der Beitrag stellt zunächst Konzeptionen und Kernergebnisse einiger Forschungsarbeiten vor. Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, wird ein repräsentativer Überblick zur Forschungslage in quantitativer Hinsicht ermöglicht. Bis anhin fehlen überzeugende kompetenztheoretisch angelegte Konzepte, um die empirische Erforschung der politischen Bildung voranzubringen. So gibt es kaum Übereinkünfte in der Bestimmung von Politikkompetenz und ihren Graduierungen. Aus diesem Grund wird nach der Darstellung der Forschungslage im zweiten Teil des Beitrages die Notwendigkeit von theoretisch gestützten Untersuchungen zum Konstrukt der politischen Urteilskompetenz betont.
Deutscher Bildungsserver
Linktipps zum Thema: „Kritik der politischen Bildung“
Allgemeiner Teil
Jaap Dronkers/Silvia Avram
Choice and Effectiveness of Private and Public Schools in seven countries. A reanalysis of three PISA dat sets
In internationalen Vergleichstudien hat sich gezeigt, dass es für den Vergleich der Effizienz von Privatschulen mit staatlichen Schulen notwendig ist, zwischen finanziell unabhängigen und staatlich alimentierten Privatschulen zu unterscheiden. Denn obwohl die Leistungsunterschiede zwischen dem privaten und staatlichen Sektor überwiegend auf die Selektivität der Privatschulen zurückgeführt werden kann, zeigen sich doch über Nationen hinweg konsistent bessere Leistungen für die staatlich alimentierten Privatschulen auch dann, wenn die Selektivität berücksichtigt wird. Unter Verwendung eines noch effizienteren statistischen Verfahrens zur Kontrolle der Selektivität erweist sich dieses Befundmuster in der Analyse dreier PISA Datensätze als robust für Deutschland und die Niederlande.
Thomas Olk/Karsten Speck
Was bewirkt Schulsozialarbeit? – Theoretische Konzepte und empirische Befunde an der Schnittfläche zwischen formaler und non-formaler Bildung
Unterschiedliche Formen der Kooperation von Jugendhilfe und Schule haben in bildungspolitischen Reformvorhaben der letzten Jahre (z.B. Ganztagsschulprogramm des Bundes) eine wachsende Bedeutung erhalten. Dennoch ist das empirisch gesicherte Wissen über die Effekte der Kooperation nach wie vor relativ begrenzt. Am Beispiel der Schulsozialarbeit, die als die engste Form der Kooperation von Jugendhilfe und Schule gilt, analysiert der Beitrag den Wissensstand zu den Wirkungen, Wirkungszusammenhängen und Grenzen der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule in der Gestalt von Handlungsprogrammen der Schulsozialarbeit. Mit Hilfe einer Metaanalyse vorliegender empirischer Studien werden die bisher generierten Erkenntnisse, die Defizite und Blindflecken vorhandener Forschung sowie die fachlichen und methodischen Herausforderungen für die Weiterentwicklung der Wirkungs- und Nutzerforschung erörtert.
Klaus Zierer
Eklektik in der Pädagogik. Grundzüge einer gängigen Methode
Eklektik ist zwar kein Terminus technicus der Pädagogik, wie ein Blick in einschlägige Lexika zeigt. Dennoch taucht sie immer wieder als wichtiger Diskussionsbegriff auf. Es scheint, dass ein eklektisches Vorgehen unabdingbar für Fragen der Bildung und Erziehung ist. Jeder Pädagoge, egal ob Praktiker oder Theoretiker, muss Eklektiker sein – so lautet daher die zentrale These des vorliegenden Beitrages, die mithilfe einer vergleichenden Analyse von nationalen und internationalen Studien zu stützen versucht wird, um schließlich Grundzüge einer eklektischen Methode formulieren zu können. Ausgangspunkt ist dabei August Hermann Niemeyer als Primus inter Pares einer Eklektik in der Pädagogik.
Besprechungen
Walter Hornstein
Marc Zirlewagen (Hrsg.): „Wir siegen oder fallen“. Deutsche Studenten im Ersten Weltkrieg
Rita Casale
Christa Kersting: Pädagogik im Nachkriegsdeutschland. Wissenschaftspolitik und Disziplinentwicklung 1945 bis 1955
Jens Trein
Michael Winterhoff (unter Mitarbeit von Carsten Tergast): Warum unsere Kinder Tyrannen werden. Oder: Die Abschaffung der Kindheit
Isabell van Ackeren
Rudolf Tippelt (Hrsg.): Steuerung durch Indikatoren. Methodologische und theoretische Reflektionen zur deutschen und internationalen Bildungsberichterstattung
Jörg Fischer
Sirikit Krone/Andreas Langer/Ulrich Mill/Sybille Stöbe-Blossey: Jugendhilfe und Verwaltungsreform. Zur Entwicklung der Rahmenbedingungen sozialer Dienstleistungen
Silke Grafe
Ida Pöttinger/Sonja Ganguin (Hrsg.): Lost? Orientierung in Medienwelten. Konzepte für Pädagogik und Medienbildung
Dokumentation
Pädagogische Neuerscheinungen