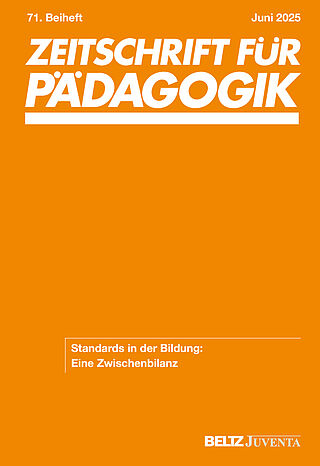- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Thementeil: Bildkompetenz
Roland Reichenbach/Nicolaj van der Meulen
Ästhetisches Urteil und Bildkompetenz
Einleitend zum Thementeil
Käte Meyer-Drawe
Die Macht des Bildes – eine bildungstheoretische Reflexion
Als Bildner unserer selbst schaffen wir uns Vor-Bilder, die in unserer Medienwelt ein Eigenleben entfalten und die auf uns zurückwirken, indem wir uns in ihnen spiegeln. Ein Verzicht auf Bilder ist im Bildungsprozess unmöglich, weil uns unsere sinnliche Wahrnehmung mit Blick auf uns selbst im Stich lässt. Der Ohnmacht des Selbst, die in einer Versagung, in einer ständigen Unruhe darüber gegründet ist, dass „sich jeder selbst der Fernste ist“ (Nietzsche), entspricht somit eine Macht der Bilder, die darin besteht, dass sie eine – wenn auch nur vorläufige –Antwort auf diesen provokativen Selbstentzug geben. Der in diesem Sinne Gebildete weiß um den Zauber sowie die Vorläufigkeit der Bilder und kennt die Gefahr, die mit jeder Versteinerung droht.
Nicolaj van der Meulen
Bildkompetenz an der Kreuzung von Visueller Kommunikation und Bildtheorie
Unerledigte Anfragen an den Kunstunterricht
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit Frage, welche Schlüsse jüngere Resultate aus der Bildtheorie für den Begriff der Bildkompetenz erlauben. Im Fokus der Kritik steht ein Verständnis von Bildkompetenz, nach der es sich beim Verstehen von Bildern um eine rationale Übersetzungsleistung handle, bei der Bildliches decodiert und auf diesem Wege ein vermeintlich eigentlicher Blick auf die Realität eröffnet würde. Fragwürdig ist hierbei sowohl die Vorstellung, Bildkompetenz eröffne einen unmittelbaren Zugriff auf eine dahinter liegende „wahre“ Realität als auch die Auffassung vom Bild als ein Code- und Symbolsystem. Ein Rückgang auf den Begriff der Visuellen Kommunikation soll deutlich machen, dass es sich bei einem weiter gefassten Verständnis von Bildkompetenz um ein unerledigtes Desiderat in Hinblick auf den Kunstunterricht handelt.
Hans Utz
Geschichtsunterricht: Zeit + Bild + Film
Bilder über Vergangenheit haben bei der Verarbeitung von Geschichte die Funktion, historische Ereignisse für die Betrachtenden zu Erlebnissen zu verdichten. Bewerten die Betrachtenden diese Erlebnisse, können sie Erfahrungen sammeln und damit ihren Erfahrungsschatz bereichern. Die Bilder werden für sie bedeutungsvoll. Voraussetzung ist allerdings, dass die Bilder authentisch wirken, das heißt, dass sie in einem als real erkannten und anerkannten historischen Kontext stehen. Der folgende Beitrag untersucht, wie Bilder mit diesem doppelten Anspruch nach Bedeutung und Authentizität fertig werden. Er unternimmt dann einen Transfer zu Filmen, die er als schon vom Hersteller gereihte Serienbilder versteht. Um Filme gleichzeitig authentisch und bedeutungsvoll werden zu lassen, bedienen sich Filmschaffende verschiedener Strategien. Der Beitrag entwirft eine systematische, historisch verankerte Gliederung.
Regula Fankhauser Inniger/Peter Labudde-Dimmler
Bildrezeption und Bildkompetenz im naturwissenschaftlichen Unterricht:
Herausforderungen und Desiderata
Was bedeutet Bildkompetenz im Kontext naturwissenschaftlichen Unterrichts und naturwissenschaftlicher Allgemeinbildung? Der folgende Beitrag fokussiert die rezeptive Seite von Bildkompetenz und wirft einen ersten, eher allgemeinen Blick auf drei noch weitgehend brachliegende Untersuchungsfelder: Im ersten Kapitel wird ein anschlussfähiger Theorieansatz entworfen. Im zweiten wird die Thematik innerhalb der aktuellen bildungspolitischen Diskussion zu Bildungsstandards verankert, und im dritten stehen exemplarisch empirische Forschungsergebnisse im Mittelpunkt. Aus den drei Untersuchungsfeldern werden im letzten Kapitel Forschungsdesiderata abgeleitet, welche gleichermaßen Theoriebildung, empirische Forschung und didaktische Umsetzung betreffen.
Deutscher Bildungsserver
Linktipps zum Thema „Bildkompetenz“
Allgemeiner Teil
Georg Breidenstein
Überlegungen zu einer Theorie des Unterrichts
Der Beitrag wendet sich zunächst den gängigen Konzeptualisierungen schulischen Unterrichts zu, um die Behauptung, dass eine neue theoretische Perspektive auf Unterricht notwendig ist, zu plausibilisieren. Er plädiert seinerseits für einen mikrosoziologischen Zugriff auf die Unterrichtssituation, der in der Lage ist, schulischen Unterricht als interaktives und kommunikatives Geschehen in eigenem Recht zu beschreiben. In einem zweiten Schritt werden einige empirische Phänomene angesprochen, die die Theoretisierung schulischen Unterrichts herausfordern, wie etwa die relative Indifferenz des Unterrichts gegenüber der Sinnfrage oder die Verselbstständigung der Praxis der Leistungsbewertung. Schließlich werden einige Bausteine für eine zu entwickelnde Theorie des Unterrichts skizziert: Unterricht als Interaktionsordnung; Organisation und Interaktion; die Darstellung und Kommunikation von „Lernen“; die Bewertung und Zurechnung von „Leistungen“ zu Personen und schließlich die Bedeutung der Peer Kultur der Schülerinnen und Schüler.
Marc Thielen
Jenseits von Tradition – Modernität und Veränderung männlicher Lebensweisen in der Migration als Provokation für die (Sexual-)Pädagogik
Gegenwärtige sexualpädagogische Fragestellungen fokussieren eine Pädagogik vielfältiger Lebensweisen, die Subjekten von Erziehungsprozessen eine Vielfalt an geschlechtlich-sexuellen Erlebnisweisen eröffnen will. Entsprechend geraten heterogene Sexualitäten, Lebensweisen, Paarbeziehungen, Familien- und Freundschaftsformen in den Blick. Demgegenüber schreiben interkulturelle Diskurse muslimischen Migranten tendenziell traditionelle Lebensweisen zu, die auf strikt heterosexuellen Beziehungen und patriarchaler Dominanz beruhen. Den Diskurs um „fremde Männlichkeit“ kritisch reflektierend rekonstruiert der vorliegende Beitrag geschlechtlich-sexuelle Wandlungsprozesse iranischstämmiger Männer in der Migration und interpretiert diese als Lern- und Bildungsprozesse. Die biografischen Selbstzeugnisse der Befragten fordern die Einwanderungsgesellschaft zu einer Reflexion eigener heteronormativer Ordnungsmuster auf, welche die Vielfalt und Veränderbarkeit geschlechtlich-sexueller Lebensweisen einschränken und reglementieren.
Dina Kuhlee/Jürgen van Buer
Bildungspolitische Leitbilder und Realitäten des Bildungssystems: Zu den Chancen Lebenslangen Lernens bei benachteiligten Jugendlichen
Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der Möglichkeit für sogenannte benachteiligte Jugendliche, ihre im Kontext des institutionell gegliederten Bildungssystems weniger ‚erfolgreichen‘ Bildungskarrieren durch Lebenslanges Lernen zu korrigieren. Dabei werden zunächst die bildungspolitischen Intentionen diskutiert, die im Diskurs um das Lebenslange Lernen aufgezeigt werden. Diesen Intentionen werden für diese Personengruppe die institutionellen Strukturen des Bildungssystems und deren mögliche Relevanz für die Gestalt biographischer Verlaufsmuster und insbesondere für die rationale Bewertung von und die Bereitschaft zu Lebenslangem Lernen gegenüber gestellt. Deutlich wird eine weitgehend fehlende Passfähigkeit von bildungspolitischen Forderungen hinsichtlich Lebenslangen Lernens auf der einen Seite und den institutionellen Realitäten zur Ausbildung und Umsetzung eines solchen Lernens auf der anderen. Entgegen den (bildungs-)politischen Diskussionssträngen dienen letztere eher der Stabilisierung sozialer Differenzen in der Bildungsteilhabe als deren Auflösung.
Besprechungen
Marcelo Caruso
Sandra Rademacher: Der erste Schultag. Pädagogische Berufskulturen im deutsch-amerikanischen Vergleich
Jörg Fischer
Peter Bleckmann/Anja Durde (Hrsg.): Lokale Bildungslandschaften. Perspektiven für Ganztagsschulen und Kommunen
Hans-Ulrich Grunder/Mascia Rüfenacht
Gerhard de Haan/Tobias Rülcker: Der Konstruktivismus als Grundlage für die Pädagogik
Wilfried Plöger
Klaus Moegling: Kompetenzaufbau im fächerübergreifenden Unterricht – Förderung vernetzten Denkens und komplexen Handelns
Ralf Schieferdecker
Sara Fürstenau/Mechthild Gomolla (Hrsg.): Migration und schulischer Wandel: Band 1: Elternbeteiligung und Band 2: Unterricht
Dokumentation
Pädagogische Neuerscheinungen