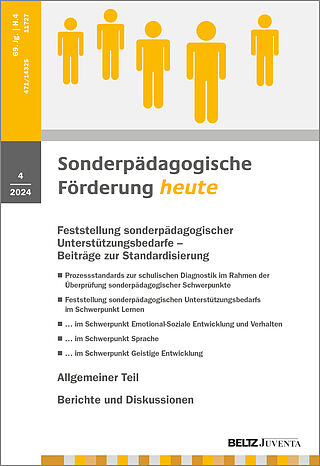- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
mit den Beiträgen im Thementeil dieses Heftes möchten wir Sie für das Problem der Vorbereitung und Realisierung beruflicher Integration junger Menschen mit Behinderung sensibilisieren. Unabhängig davon, in welchem Bereich der Sonderpädagogik Ihre Tätigkeit liegt, können Sie letztendlich durch Ihr Engagement auf wissenschaftlichem Gebiet und im Praxisfeld zur Lebensbewältigung der uns – im engeren oder weiteren Sinne – anvertrauten jungen Menschen beitragen. Arbeit in ihrer sinnstiftenden Funktion ist mehr als nur die Sicherung materieller Existenz – sie schafft persönliche Identität und verleiht gesellschaftliche Anerkennung. Angesichts tief greifender Veränderungen des Arbeits- und Wirtschaftslebens stellt Gerhard H. Duismann in seinem Beitrag die Frage, ob Arbeit noch die zentrale Kategorie unseres Lebens ist und beantwortet sie eindeutig positiv in seinem Fazit: »Arbeit ist und bleibt in doppelter Weise, physisch und psychisch, existenznotwendig. Vorbereitung auf diese nach- und außerschulische Phase muss in Schulen, so auch in Förderschulen im Zentrum des Lernens für das Leben stehen.« Dabei betrachtet er Arbeit, auf die Jugendliche vorbereitet werden müssen, unter dem Aspekt der beruflichen Tätigkeit und der Tätigkeit zur selbstständigen Bewältigung des eigenen Lebens. Was in diesem Zusammenhang im Rahmen des EU-Projektes Netzwerk Berliner Schülerfirmen geleistet werden kann, wird beispielhaft beleuchtet. Ausgehend von der nachschulischen Ausbildungs- und Arbeitssituation von Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung initiierten Peter Pfriem und Jürgen Moosecker eine Befragung an der Schule für Körperbehinderte, um u.a. Berufswünsche, Quellen der Etablierung des Berufswunsches, notwendige Arbeitstugenden aus Schülersicht, eigene Erwartungen an die zukünftige Arbeit zu ermitteln. Auf dieser Basis entwickeln sie vielfältige Überlegungen und mögliche Konsequenzen zur Qualifizierung der Berufswahlvorbereitung dieses Personenkreises. Berufliche Orientierung und Berufsausbildung von Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist ein Prozess, an dem eine Vielzahl von Personen und Institutionen unmittelbar und mittelbar beteiligt ist. Deren Anliegen besteht zwar in einer erfolgreichen Vorbereitung und Ausbildung der Jugendlichen, aber das gemeinsame Verfolgen des Weges in Kooperation findet kaum statt. Demotivierte und desorientierte Schülerinnen und Schüler stellen das Bemühen oft infrage. Besonders alarmierend ist die hohe Abbrecherquote in der beruflichen Ausbildung, deren Ursachen in fehlender Sinnbildung, Sinnverlust und/oder destruktiver Freizeitgestaltung zu erkennen sind. (s. Beitrag) Welche Ansätze, Initiativen und Lösungsmöglichkeiten gefunden wurden, um diesen sensiblen Bereich auch möglichst im Dialog mit den Betroffenen effizienter zu gestalten, wird im Beitrag von Carola Schwager, Axel Harms und Lutz Schörner beschrieben. Wenn Jörg M. Kastl und Rainer Trost feststellen, dass für Menschen mit Behinderungen der Einstieg oder Wiedereinstieg ins Erwerbsleben in vielen Fällen ein äußerst riskanter und stets labiler Übergangsprozess mit häufig offenem Ausgang ist, dann lässt sich – wie auch im o.g. Beitrag – die ganze Bandbreite von Einzelschicksalen erahnen. Der Weg vieler benachteiligter oder behinderter junger Menschen führt oft von der Schule in eine Maßnahmekarriere mit ungewissem Erfolg. Das ist für die Autoren Anlass, deutliche Akzente für die Arbeitsweise der ab dem Jahr 2000 bundesweit institutionalisierten Integrationsfachdienste in Deutschland zu setzen und anzumahnen, die Erfahrungen aus den Bundesmodellprojekten für die neue Gestaltung zu nutzen. Es bleibt zu hoffen, dass wir Ihnen mit den ausgewählten Beiträgen Bestätigung für das eigene Tun, Anregungen und Ideen für weiteres Überlegen und Handeln im Prozess der beruflichen Vorbereitung und Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderung übermitteln konnten.
Ortrud Marsand