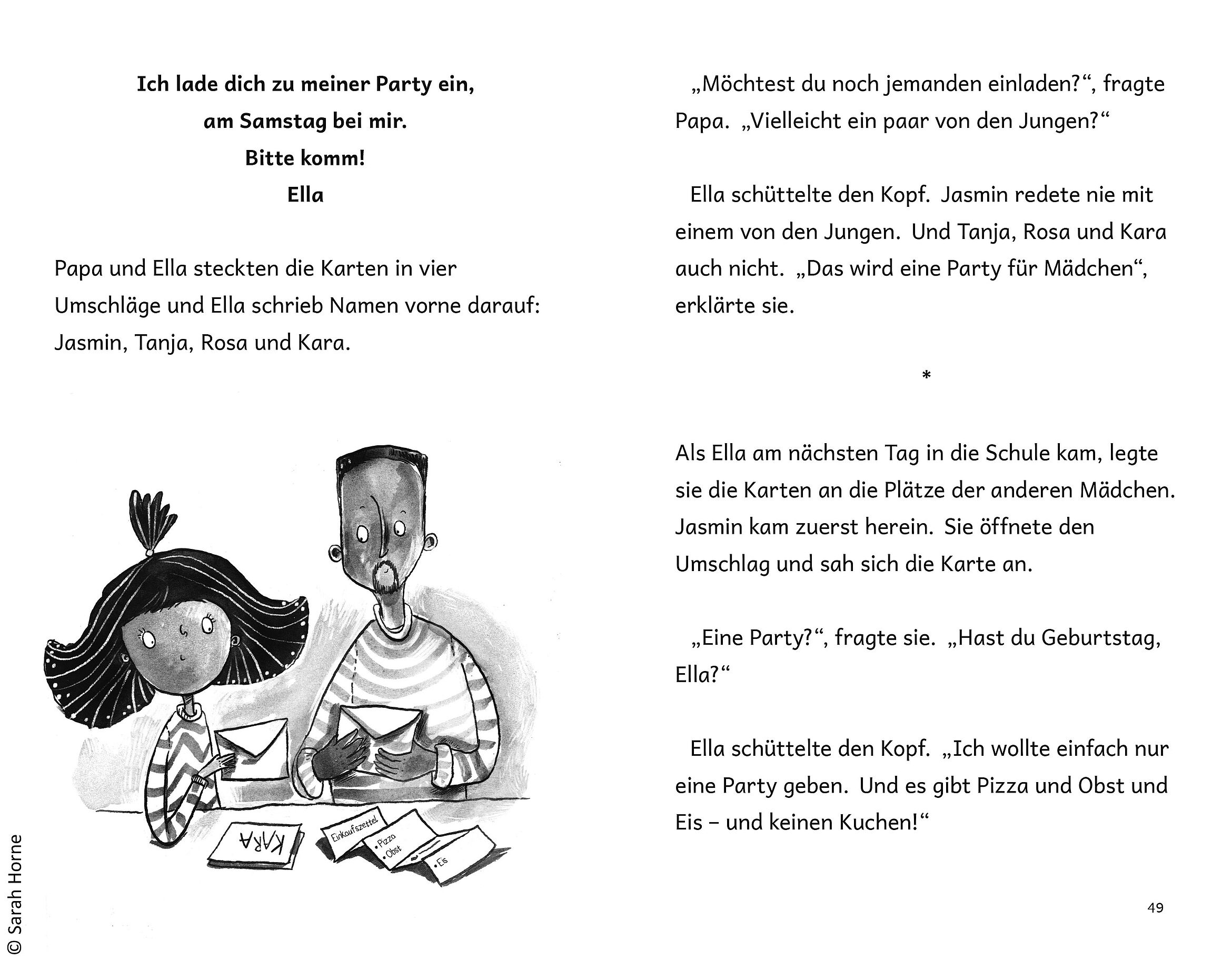- Kinder- & Jugendbuch
-
Fachmedien
- Fachmedien
- Erziehungswissenschaft
- Frühpädagogik
- Pädagogik
- Psychologie
-
Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Sozialpädagogik/Soziale Arbeit
- Übersicht
- PRODUKTE
- Neuerscheinungen
-
ZEITSCHRIFTEN
- ZEITSCHRIFTEN
- Betrifft Mädchen
- Deutsche Jugend
- Forum Erziehungshilfen
- Gemeinsam leben
- Kriminologisches Journal
- Migration und Soziale Arbeit
- Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit
- Pflege & Gesellschaft
- Soziale Probleme
- Sozialmagazin
- Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit
- Zeitschrift für Sozialpädagogik
- Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation
- SERVICE
- Enzyklopädie Soziale Arbeit Online (ESozAO)
- Open Access
- Autor:innen
- Manuskripte
- Soziologie
- Training, Coaching und Beratung
- Sachbuch/ Ratgeber
- Service
- Leseförderung
- Leseförderung
- Blog
- Von »super readable« in »super lesbar« übersetzen – super schön, aber nicht super leicht
Von »super readable« in »super lesbar« übersetzen – super schön, aber nicht super leicht

Schon bevor ich für die Reihe »super lesbar« übersetzen durfte, hatte ich in anderen Ländern Kinder- und Jugendroman-Reihen entdeckt, die mit speziellem Layout, linearer Erzählweise, geringem Textumfang und eher einfacher Sprache Rücksicht auf Kinder und Jugendliche mit Leseschwierigkeiten nahmen. Daher fragte ich in einem Artikel für die Fachzeitschrift Eselsohr (12/2018), wann es auch bei uns super lesbare Bücher geben würde. Da ahnte ich noch nicht, dass ich bereits ein halbes Jahr später solche Texte übersetzen sollte, weil auch Gulliver schon in diese Richtung dachte. Es freut mich enorm, dass wir nun mit einer wachsenden Vielfalt von Büchern Kindern und Jugendlichen entgegenkommen, denen Lesen noch viel Mut und Geduld abverlangt. Ihnen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, die sie mit den gängigen Romanen für ihr Alter noch nicht haben könnten, liegt mir am Herzen.
Und wie so oft ist das, was leicht aussieht, das Ergebnis detailverliebter Feinarbeit mit viel Stirnrunzeln, Abwägen, Gedankenaustausch (in diesem Fall hauptsächlich mit dem Lektorat, aber auch mit Menschen, die persönliches Erfahrungswissen zu LRS haben und nicht der Buchbranche angehören), Ausprobieren und Ändern. Nebenbei erweitere ich durch Fachlektüren mein Wissen. So ergibt sich für mich ein spannender, unendlicher Lernprozess, der durch die entstehenden Übersetzungen den Leser*innen und ihren Erwachsenen weiterhilft.
Verflixte Unterschiede
Bei diesen Übersetzungen fluche und jammere ich zum Beispiel regelmäßig darüber, wie unfair es ist, dass englische Wörter oder zusammengesetzte Begriffe oft schön kurz und einfach gebaut sind, während ihre deutschen Entsprechungen Buchstabenmonster sind – zumindest aus der Warte eines Kindes, das noch leicht aus dem Lesefluss gebracht wird von Wörtern mit mehr als fünf, sechs Buchstaben oder Konsonantenknubbeln am Wort- oder Silbenanfang, womöglich gar in Wörtern, die es noch nicht kennt. Eine Kostprobe: Ich überlege in einer aktuellen Übersetzung noch, ob ich das wunderschön einfache »jam tart« wirklich als »Törtchen mit Marmeladenfüllung« oder »Marmeladen-Törtchen« übersetze, oder ob die Hauptfigur vielleicht ersatzweise etwas anderes naschen dürfte, das sich leichter liest (Kekse?). Dazu muss ich allerdings noch nachschauen, ob die jam tarts vielleicht in einer Abbildung auftauchen, denn dann erübrigt sich die Idee. Je nach Text und angestrebtem Leseniveau löse ich solche Knobelaufgaben mehrfach pro Kapitel oder gar Seite, bei variablem Schwierigkeitsgrad für mich und für die Leser*innen. Manchmal muss ich ihnen notgedrungen, aber auch überlegt zumuten, an Herausforderungen zu wachsen. Sie haben es nun einmal mit dieser verzwickten deutschen Sprache zu tun, sodass sie sich über kurz oder lang auf Wortmonster einlassen müssen. Wichtig bleibt mir allerdings, dass diese »Ringkampfgegner« nicht unfair stark sind und nur selten in den Weg geraten, damit zwischen den Herausforderungen viel gut schaffbare Strecke liegt. Manchmal überlege ich auch, wie heikel es wäre, wenn jemand beim Lesen genau dieses eine Wort nicht schaffte – hat dieser Mensch dann keine Chance mehr, den Textsinn zu erfassen, oder lässt sich die Geschichte trotzdem noch gut verfolgen? Kann ich das absichern? Ich möchte schließlich, dass die jungen Menschen in einen Lesefluss und ans Ziel kommen und nicht erschöpft strauchelnd unterwegs aufgeben müssen.
Ein weiterer gängiger Anlass zum Seufzen, Grübeln und Lösen von Problemen entspringt Unterschieden der englischen und deutschen Grammatik und Stilistik: In den Originaltexten sind oft nicht nur die Wörter so schön kurz und einfach, nein, viele englische Sätze kommen mit weniger Wörtern und Kommas aus. Das hat unter anderem damit zu tun, dass man dort gern das Gerundium an Stellen benutzt, wo wir statt eines Partizip Präsens lieber einen Nebensatz benutzen (erfundenes Beispiel: »By writing this, I am complaining about the job I do love« sind 12 Wörter, 57 Zeichen mit Leerzeichen, 1 Komma, im Vergleich zu »Indem ich dieses schreibe, beklage ich mich über die Arbeit, die ich doch eigentlich liebe«, 15 Wörter, 90 Zeichen, 2 Kommas). Häufig wird im Original also etwas in wenigen Silben, Worten, Zeilen erzählt und rutscht dadurch relativ flott ins Gehirn der Lesenden. Das ist beim Verstehen der Zusammenhänge im Textverlauf komfortabel für das Arbeitsgedächtnis. Wenn ich einen Satz ins Deutsche hole, kommen dabei im ersten Anlauf oft sehr viel mehr Buchstaben zusammen, pro Wort und pro Satz. Für meine Leserinnen und Leser ergibt sich daraus deutlich mehr Lesezeit für manchen Ausdruck und die Strecke vom Satzanfang bis zum Satzende. Und noch dazu haben wir oft Klammerstrukturen in unseren Sätzen, die den Zwischenspeicher und das Vorhersagevermögen fordern (zweiteilige Verben, zwischen Artikel und Substantiv eingeschobene Attribute). Wenn ich dann bedenken will, dass deutschsprachige Kinder nicht automatisch ein entsprechend ausgedehntes Arbeitsgedächtnis haben, muss ich überlegen, wie ich vorgehen kann, damit sich auch bei ihnen die Informationen in der nötigen Geschwindigkeit im Kopf miteinander verketten können. Schauen Sie sich nun den gerade gelesenen Satz noch einmal an: Als erfahrene, schnelle Leser*innen konnten Sie, falls Sie gerade hellwach sind und Ruhe und Interesse haben, etwas ziemlich Komplexes wahrnehmen – weil Sie Ihr Arbeitsgedächtnis dabei hauptsächlich für den Inhalt nutzen konnten und keine Kraft mehr für die Worterkennung brauchten. Ich habe zunächst nur »laut« überlegt, dass ich möglicherweise etwas bedenken will. Dann habe ich benannt, was ich bedenken will. Dabei habe ich mich auf den vorherigen Satz bezogen (also Ihre Erinnerung eingefordert) und auch noch erwartet, dass Sie grundsätzlich im Kopf haben oder schnell erschließen können, was das Arbeitsgedächtnis mit dem Lesen zu tun hat. Danach erst habe ich gesagt, welcher Schritt folgt, wenn ich das Erwähnte wirklich bedenke: Ich muss mir etwas überlegen. Was genau? Die Art, wie ich beim Übersetzen vorgehe. Im letzten Nebensatz habe ich schließlich erklärt, was ich gegebenenfalls erreichen möchte: Die Kinder sollen alle Infos in der passenden Reihenfolge in den Kopf bekommen, damit sich der Sinn leicht erschließt. Wie ich das anstellen will, habe ich bis hierhin immer noch nicht verraten. Ich habe nur Ihre Erwartung geweckt, dass dazu gleich noch etwas kommt. Ein solches Wort- und Gedankenaufkommen in nur einem langen Satzgefüge kann ich passend routiniert Lesenden zumuten. Aus dem Aufbrechen in Info-Einheiten in meiner Erklärung können Sie aber entnehmen, wie ich vorgehe, wenn mir die Sätze beim Übersetzen ins Deutsche zu komplex für »super lesbar« werden: Ich portioniere und sortiere Infos. So komme ich zu kürzeren Sätzen. Das ist nicht immer leicht. Aber mit einem Mix aus theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung geht oft mehr, als man im ersten Moment erwartet.
Mit Tricks und Kniffen arbeiten
Falls auch nach dem Portionieren eine Satzstruktur etwas komplex bleibt, schaue ich mir die Lesbarkeit auf Wortebene noch einmal genau an: Besteht der Satz zum Glück nur aus leichten Wörtern? Dann wage ich es, die Lesenden beim Satzverstehen ein wenig mehr zu fordern. Was aber, wenn der Satz schwer zu lesende oder zu verstehende Wörter enthält, die vielleicht auch noch fremd sind? In diesen Fällen wäge ich Möglichkeiten ab: Kann ich auf leichtere Ersatzwörter ausweichen (»Bücherschrank« durch »Regal« ersetzen, falls keine Abbildung im Buch und kein Bezug im Text dagegenspricht?)? Kann ich lange oder wenig vertraute Komposita mit Bindestrich schreiben? Brauche ich wirklich das Kompositum, oder reicht ein Teil davon (Tasche statt Anzugtasche/Anzug-Tasche)? Muss ich zwingend schreiben, dass die Figur etwas Bestimmtes sehen kann, oder darf ich an der Stelle einfach sagen, dass sie es sieht, und damit ein Wort einsparen? Ich versuche also, Schwierigkeiten durch Erleichterungen auszubalancieren. Bei Bedarf fragen wir via Originalverlag beim Autor oder der Autorin um Erlaubnis für eine kleine Änderung.
Fragen der Technik
Zwischendurch nutze ich automatische Testmöglichkeiten, um zu sehen, wie es etwa um meine durchschnittliche Satzlänge oder den Prozentsatz langer Wörter bestellt ist (LIX-Rechner auf www.psychometrica.de oder ratte.lesedidaktik.net oder FLESCH-Rechner www.fleschindex.de/berechnen). Gefallen mir die Werte nicht, überarbeite ich den Text weiter.
Um Entlastungen geht es mir auch bei Angaben, wer gerade spricht: Sie stehen oft zwischen zwei (Halb-)Sätzen oder erst hinter der Aussage. Oder sie entfallen. Kinder mit Leseschwierigkeiten haben aber vor lauter Konzentration aufs Erkennen der Wörter und des Sinns seltener den Kopf dafür frei, nebenbei selbst die wörtliche Rede der passenden Figur zuzuordnen. Zu wissen, wer spricht, ist aber wichtig fürs Textverstehen. Während die britischen Kinder, siehe oben, oft schon nach wenigen Silben die Auflösung entdecken können, müssen deutschsprachige häufig mehrere Zeilen warten – um dann eventuell festzustellen, dass der Satz nicht nur von einer anderen Figur als erwartet geäußert wurde, sondern auch gar nicht entschlossen gerufen, sondern ängstlich geflüstert. Also stelle ich da, wo es mir wichtig erscheint, diese Angabe lieber voran – für weniger Stocken und Zurückspulen im Kopfkino.
Unendliche Lernmöglichkeiten
Und noch ein paar Beispiele für meine Alltagsfragen: Wenn junge Leser*innen englische Lehnwörter mündlich benutzen – erkennen sie die schon schriftlich wieder? Nehme ich als Entsprechung für »amazing« lieber »toll« (nicht so aussagestark), »genial« (wohl eher Erwachsenenstil) oder »mega« (Modewort, vielleicht schon bald out)? Kniffelig sind Entscheidungen zwischen einem bekannteren, aber schwerer zu erfassenden Wort und einem leichter zu erlesenden, aber vermutlich weniger Kindern bekannten.
Dabei muss ich versuchen, unterschiedliche Menschen einzuschätzen und einen gemeinsamen Nenner zu treffen: Hochgradig vorgebildeter Akademikernachwuchs kann einen ganz anderen Wortschatz haben als Schüler*innen aus Familien mit sehr einfacher Umgangssprache. Es kann genauso eine Rolle spielen, ob Deutsch die Erst- oder Zweitsprache ist, welche Interessen jemand pflegt, ob das Sprachverstehen vielleicht durch eine Sprachentwicklungsstörung, Autismus oder ähnliche Herausforderungen beeinträchtigt ist oder wie es um die Frustrationstoleranz und den Mut bestellt ist.
Und ich weiß nichts über den Lese-Moment: Ist es der erste unsichere Kontakt mit einem Roman? Oder ist es schon das fünfte super lesbare Buch, bei bereits gewachsenem Selbstvertrauen? Liest jemand allein oder mit Unterstützung? Ist er oder sie müde oder wach? Bequem, skeptisch oder frisch motiviert?
Ich habe es also mit einem bunten Mix an Herausforderungen und Unvorhersehbarem in den Texten und beim Lesepublikum zu tun – und werde beim Übersetzen immer ins Grübeln kommen, mich mit Risiken und Chancen beschäftigen, mit Perspektiven spielen.
Genauso werde ich immer wieder dankbar bewundern, wie toll eine Autorin oder ein Autor in wenigen Worten und einfachen Sätzen eine packende, unterhaltsame Geschichte geschrieben hat.
Solange ich dabei helfen kann, Kinder und Jugendliche mit Erfolgserlebnissen Lesefreude entdecken zu lassen, begebe ich mich weiterhin gerne in den Ringkampf mit diesen vielen Teufeln in Details. Das ist dann meine Art, freudig an den Büchern der Reihe »super lesbar« zu wachsen.